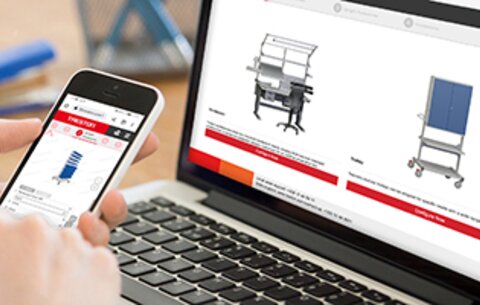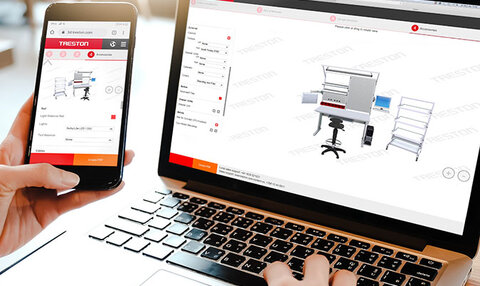Ergonomie ist Chefsache – und Teamsache
Montagmorgen, 8:17 Uhr. Die Produktionsleiterin bleibt kurz stehen. Am Ende der Linie reibt sich Paul die Schulter, hinter ihm stapeln sich Kisten, und am Bildschirmarbeitsplatz gegenüber kneift Jana die Augen zusammen, weil die Sonne über den Monitor spiegelt. Nichts Dramatisches. Und genau darin liegt die Gefahr: Ergonomische Probleme sind selten laut – aber sie nagen. An Gesundheit, Motivation und Leistung.
Ergonomie ist deshalb keine Ausstattungsliste, sondern eine Führungsentscheidung. Sie ist nicht der „bequeme Stuhl“ oder die „coole Stehoption“, sondern die Haltung eines Unternehmens, die sagt: Wir gestalten Arbeit so, dass Menschen langfristig gesund und wirksam bleiben. Diese Haltung beginnt in der Geschäftsführung – und wird von jeder Ebene, jeder Abteilung und jeder einzelnen Person im Betrieb getragen.

Recht ist Pflicht – Kultur ist Kür (und Wettbewerbsvorteil)
Wer in Deutschland führt, führt auch Arbeitsschutz. Das Arbeitsschutzgesetz verlangt eine Gefährdungsbeurteilung, die ergonomische Belastungen erfasst – körperlich wie psychisch. Die Arbeitsstättenverordnung mit ihren ASR-Regeln übersetzt Schutzziele in greifbare Gestaltung: von Beleuchtung bis Bildschirmarbeit. Betriebssicherheitsverordnung und Lastenhandhabungsverordnung verankern Ergonomie bei Arbeitsmitteln und manuellen Tätigkeiten. Dazu kommen die DGUV-Regeln, die Unterweisung, Mitwirkung und Prävention präzisieren.
Und OSHA? Klingt vertraut – ist aber US-Recht. Für Deutschland nicht bindend. Wer sich international orientiert, kann OSHA-Standards als Inspiration heranziehen; entscheidend sind hierzulande die deutschen und europäischen Vorgaben.
Gesetze setzen den Mindeststandard. Doch Kultur macht den Unterschied: Wo Führungskräfte Ergonomie zur Managementaufgabe machen, wird sie nicht zur Pflichtübung, sondern Teil der Identität – spürbar in sauber gestalteten Arbeitsplätzen, klugen Beschaffungen, gelebter Beteiligung und im Ton, mit dem über Arbeit gesprochen wird.
Die Rollen – im Fluss, nicht im Silo
Ergonomie gelingt, wenn Abteilungen ineinandergreifen und nicht nebeneinander arbeiten:
- HSE/SGU (Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz) hält die fachliche Linie: Gefährdungsbeurteilung, Maßnahmen, Wirksamkeitskontrolle. Die Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Betriebsarzt/die Betriebsärztin bringen Analyse- und Gesundheitskompetenz ein – vom Heben/Tragen bis zur Augen-Vorsorge bei Bildschirmarbeit.
- HR & BGM verankern das Thema in Onboarding, Unterweisung und Führungskräftetraining, steuern das Betriebliche Eingliederungsmanagement und bauen Programme, die Gewohnheiten verändern – nicht nur Möbel.
- Einkauf, IT und Facility Management entscheiden jeden Tag über Ergonomie – still, aber wirksam: bei der Wahl von Werkzeugen, Software, Beleuchtung, Möbeln, Flächen.
- Betriebsrat/Personalrat sorgt dafür, dass Regeln tragfähig sind – z. B. für Homeoffice und mobile Arbeit.
- Führungskräfte machen Ergonomie konkret: Sie geben Zeit fürs Einstellen von Arbeitsplätzen, fragen nach Beschwerden, korrigieren schlechte Routinen – und loben gute.
- Beschäftigte sind die Experten und Expertinnen ihrer Arbeit: Sie melden Mängel, probieren Lösungen aus, justieren, geben Feedback. Ohne sie bleibt Ergonomie Theorie.
Das Besondere: Niemand kann es allein lösen – und alle können es jeden Tag ein Stück besser machen.
Drei Szenen, die zeigen, worauf es ankommt
Szene 1 – Montage:
Das Bauteil ist schwer, der Greifer wackelt. Früher hieß es: „Zähne zusammenbeißen.“ Heute dreht die Meisterin den Spieß um: „Was braucht ihr, damit das leicht von der Hand geht?“ Der Kran bekommt eine feinfühlige Steuerung, die Palette steht 15 cm höher, der Takt wird so angepasst, dass ein zweiter Griff entfällt. Ergebnis: weniger Schulterlast, weniger Ausschuss, mehr Tempo – ohne Druck.
Szene 2 – Büro & Bildschirmarbeit:
Ein IT‑Rollout bringt neue Monitore. HSE und IT testen vorab höhenverstellbare Halterungen, HR plant eine 10‑Minuten‑Mikro-Unterweisung ins Onboarding, die Führungskräfte blocken in der ersten Woche 20 Minuten „Desk-Fit“ pro Person. Die Leute lernen: Wie stelle ich meinen Platz ein? Wann mache ich Mikropausen? Woran merke ich, dass Software mich unnötig belastet – und wie melde ich das?
Szene 3 – Mobile Arbeit:
Nicht jeder Küchentisch ist ein Telearbeitsplatz. Das Unternehmen unterscheidet sauber: Telearbeit (mit vereinbarter Ausstattung) vs. mobile Arbeit (unterwegs, wechselnde Orte). Statt „Mach mal irgendwie“ gibt es klare Richtlinien, Checklisten, Leih-Equipment und eine Hotline, die nicht fragt „Warum schon wieder?“, sondern sagt: „Danke fürs Melden – wir justieren das.“
Was Führung konkret ausmacht
Ergonomie scheitert selten an fehlendem Wissen – sie scheitert an Prioritäten. Führung zeigt sich nicht in der nächsten Kampagne, sondern in drei einfachen, unbequemen Entscheidungen:
- Wir messen, was zählt.
Nicht nur Unfälle, sondern auch Vorboten: Meldungen zu Beschwerden, ergonomische Störungen im KVP, First‑Fix‑Rate bei Tickets, Unterweisungsquote, Beteiligung im Arbeitsschutzausschuss. Zahlen erzählen Geschichten – wenn man sie liest. - Wir beschaffen mit Blick auf Menschen.
Ein Werkzeug, das 5 % günstiger ist, aber 20 % schwerer, ist am Ende teuer. Wir geben Einkäufern, IT und FM die Ergonomie‑Vorgaben, die sie brauchen, um klug zu entscheiden. - Wir geben Zeit – nicht nur Ansagen.
Ein Arbeitsplatz ist erst dann „ergonomisch“, wenn er eingerichtet ist. Wer zehn Minuten fürs Einstellen nicht erlaubt, zahlt später mit Fehlzeiten. Zeit zum Justieren ist kein Luxus, sondern Führungshandeln.
„Kostet das nicht alles Geld?“ –
Ja. Und Nichtstun kostet mehr.
Die wahren Kosten liegen selten im Regal – sie stecken in Mikroverlusten: langsamerem Arbeiten, Konzentrationsbrüchen, Schmerzen, die man weg atmet, Terminen, die knapp verfehlt werden, Talenten, die leise gehen. Ergonomie wandelt diese Reibungsverluste in Leichtigkeit: weniger Beschwerden, weniger Fluktuation, bessere Qualität. Das ist keine Romantik, das ist Betriebswirtschaft.
Vom Muss zum Momentum
Der Moment, in dem Paul am Ende der Linie die Schulter nicht mehr reibt, ist kein Zufall. Er ist das Ergebnis einer Kette kleiner, richtiger Entscheidungen – ausgelöst von einer Führung, die sagt: Gesund arbeiten ist Teil unserer Leistung. Und er ist das Ergebnis von Menschen, die mitmachen: der Sicherheitsbeauftragten, die nachfragt; der HR‑Kollegin, die Schulungen interessant gestaltet; des Einkäufers, der das leichtere Werkzeug bevorzugt; der Teamleiterin, die Pausen ernst meint; von Paul, der meldet – und Jana, die ihren Bildschirm nicht mehr gegen die Sonne stellt, sondern gegen Spiegelungen geschützt arbeitet.
Ihr nächster Schritt – heute
Gehen Sie heute drei Meter durch Ihren Betrieb oder Ihr Büro. Fragen Sie eine Person:
„Was nervt dich an deinem Arbeitsplatz – und was würde es leichter machen?“
Holen Sie eine Sache noch diese Woche vom Tisch (oder unters Regal): eine Halterung, eine Rampe, eine Lampe, ein Rollbrett, eine Einstellminute. Und sagen Sie dazu: „Das ist uns wichtig.“
So beginnt Kultur. So beginnt Ergonomie, die wirkt – von oben angestoßen, von allen getragen.
Wer den nächsten Schritt von der Idee zur Umsetzung gehen möchte, findet in modularen, ergonomischen Arbeitsplatzsystemen gute Ansatzpunkte. Als Inspirationsquelle eignet sich Treston – wichtig bleibt dabei: erst Anforderungen und Gefährdungen klären, dann die Ausstattung gezielt auswählen. So wird aus neuer Hardware ein wirksamer Beitrag zu Gesundheit, Qualität und Leistung.